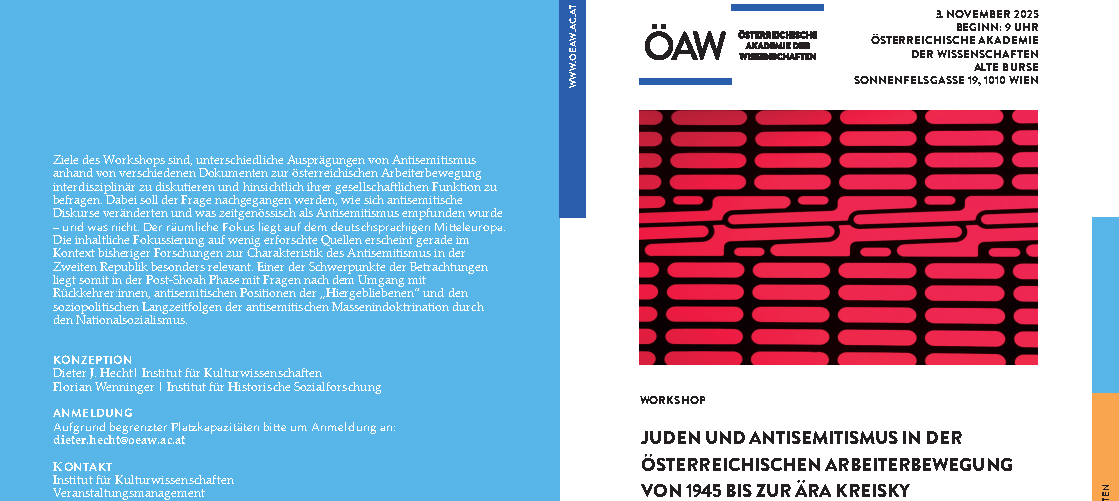
Workshop der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und dem Institut für Historische Sozialforschung
Seit ihren Anfängen war Antisemitismus für die Arbeiterbewegung ein wichtiges Thema. Einerseits bildeten insbesondere in Wien jüdische Intellektuelle eine zentrale Führungsgruppe, wobei die Sozialdemokratie mindestens bis 1934 die einzige relevante politische Kraft war, in der sich Juden und Jüdinnen einigermaßen gleichberechtigt betätigen konnten und stand die überwiegende Mehrheit der österreichischen Juden den egalitären Zielen der Arbeiterbewegung durchaus empathisch gegenüber. Anderseits war Antisemitismus in der Arbeiterschaft wie in der Gesamtbevölkerung verbreitet, spielte eine wichtige Rolle in der Agitation der politischen Gegner der Arbeiterbewegung und stellte sich von daher die Frage, wie dem strategisch wie taktisch zu begegnen sei. Nicht zuletzt gab es auch innerhalb der Arbeiterbewegung unleugbar Antisemitismus und ein Spielen mit antisemitischen Stereotypen und Argumentationsmustern. Der Begriff „Arbeiterbewegung“ ist hier im Sinne eines Integrationsmilieus zu verstehen, bestehend aus Organisationsstrukturen (Parteien, Gewerkschaften) und einem breiten Vorfeld (Kinder- und Jugendorganisationen, Sport-, Freizeit- und Kulturvereine etc.). Anliegen des Workshops ist es, jüdischen Alltag und Aktivismus innerhalb der Arbeiterbewegung unter den Gesichtspunkten jüdischer Identitäten und Antisemitismus auszuleuchten, diese zeitlich und räumlich zu differenzieren und – idealerweise - im Vergleich Muster zu identifizieren.
Ziele des Workshops sind, unterschiedliche Ausprägungen von Antisemitismus anhand von verschiedenen Dokumenten zur österreichischen Arbeiterbewegung interdisziplinär zu diskutieren und hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Funktion zu befragen. In interdisziplinärer Perspektive soll dabei auch der Frage nachgegangen werden, wie sich antisemitische Diskurse veränderten, aber auch, was zeitgenössisch als Antisemitismus empfunden wurde – und was nicht. Der räumliche Fokus liegt auf dem deutschsprachigen Mitteleuropa. Die inhaltliche Fokusierung auf wenig erforschte Quellen erscheint gerade im Kontext bisheriger Forschungen zur Charakteristik des Antisemitismus in der Zweiten Republik besonders relevant. Einer der Schwerpunkte der Betrachtungen liegt somit in der Post-Shoah Phase mit Fragen nach dem Umgang mit Rückerer:innen, antisemitischen Positionen der „Hiergebliebenen“ und den soziopolitischen Langzeitfolgen der antisemitischen Massenindoktrination durch den Nationalsozialismus.
Veranstalter: Institut für Kulturwissenschaften (ÖAW), Institut für Historische Sozialforschung (IHSF)
Konzept: Dieter J. Hecht, Florian Wenninger
Anmeldung per Email an: dieter.hecht@oeaw.ac.at